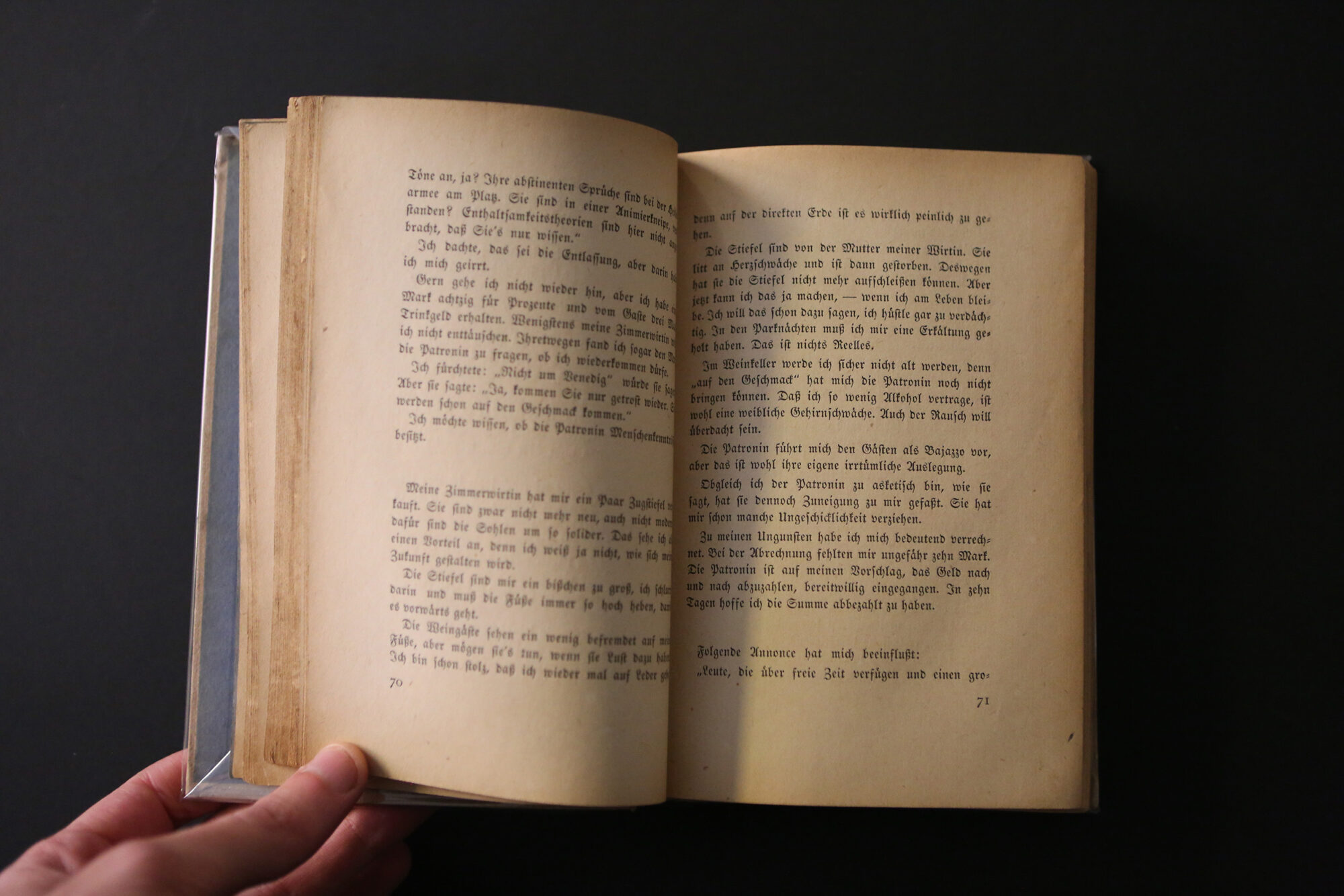Ozongeruch in einem Tagebucheintrag. Prekariat und Desinfektionsmittel 1920/2020
Ein Textausschnitt aus dem Roman »Das Brandmal« von Emmy Hennings aus dem Jahr 1920
Emmy Hennings schrieb in Das Brandmal (1920), S. 71-77:
Folgende Annonce hat mich beeinflusst:
»Leute, die über freie Zeit verfügen und einen grossen Bekanntenkreis haben, können bis zu zwanzig Mark täglich verdienen.«
Näheres erfuhr ich Luisenstrasse 8 bei Herrn Schmitz.
Er fragte mich weder nach meiner letzten Tätigkeit, noch nach meiner Schulbildung, bat mich auch nicht um kurze Angabe meines Lebenslaufes. Ich brauchte überhaupt keine weitere Auskunft zu geben, als: dass ich über freie Zeit verfüge, wenn auch nicht über den gewünschten grossen Bekanntenkreis.
Ich meinte, das liesse sich vielleicht nachholen, er möge die Güte haben, mir schnell zu sagen, welche Arbeit er zu vergeben habe, ich sei vollkommen auf Arbeitslust eingestellt und gewillt, jede einigermassen anständige Tätigkeit zu leisten. Dabei sah ich mich in dem kahlen Zimmer um, das allerdings wenig Arbeitsaussichten bot, denn es war nur ein wackliger Tisch da und die beiden Rohrstühle standen in angemessener Entfernung, als solle dieses Arrangement vornehm wirken.
Herr Schmitz schien nicht viel Irdisches zu verschenken zu haben. Seinen ärmlichen braunen Baumwollanzug schützte ängstlich eine grüne alte Gärtnerschürze.
»Meine Frau wird gleich erscheinen,« sagte er, und indessen – es dauerte reichlich lange – sassen wir schweigend, jeder auf seinem Stuhl.
Weil es nun doch ein wenig lange dauerte, sagte er:
»Das Wetter ist schon recht kalt und schlecht.«
Das sagte er in solch demütigem Ton, als gehöre das Wetter schon irgendwie zu den Unbequemlichkeiten meiner Arbeit, und deshalb sagte ich auch zuvorkommend:
»Oh, das macht mir nichts aus.«
Durch meine Antwort schien er ein wenig verlegen, und sagte leicht nervös:
»Meine Frau wird gleich erscheinen, denke ich.«
Da dachte ich, die Frau ist gewiss »etwas Besseres«, denn eine einfache Frau kommt doch schlichtweg zur Tür herein, und stellte mir das Erscheinen wie ein hereinrauschendes Schweben vor.
Der Mann war so schüchtern, dass ich ihn gar nicht zu fragen wagte nach der Art der Arbeit, die er zu vergeben habe. Ich war aufs Äusserste gespannt.
Schliesslich hörte ich Schlurfen von Filzpantoffeln, und ins Zimmer kam eine sehr gleichgültig aussehende junge Person, die etwas in der Küchenschürze trug:
»So, hier sind die Artikel, Albert.« Und dann sagte sie, sich zu mir wendend:
»Guten Tag, Fräulein. Ja wollen Sie es denn mal mit der Sache versuchen?«
Ich bejahte, ich wolle es schon versuchen, wisse aber noch nicht, womit.
Da wandte sie sich ein wenig geärgert an ihren Mann:
»Ja, hast du denn die Dame noch nicht aufgeklärt?«
Und sie packte aus ihrer Schürze einen Haufen Pakete auf den Tisch und zeigte mir die Aufmachung:
»Sehen Sie, Fräulein, das sind nämlich Desinfektionsapparate. Mein Mann hat sie leider als Zahlung übernommen, und wir haben an die Zehntausend Exemplare, und die sollen jetzt losgeschlagen werden. Was meinen Sie jetzt dazu?«
Was sollte ich wohl meinen? Da man mir soviel Selbständigkeit einräumte, erlaubte ich mir, einen »Desinfektionsapparat« zu untersuchen und stellte fest, dass es eine Art Naphthalinmasse war, in roten Karton eingerahmt und zum Aufhängen eingerichtet. In Goldbuchstaben war auf der einen Seite der Packung zu lesen: »Ozongeruch«. Auf der andern Seite stand: »Blühende Wiesen im Winter« und der Spruch: »Wer sich daran gewöhnt, lässt ungern davon.«
Da versank ich unwillkürlich in Nachdenken, aber die Frau unterbrach mich, nahm das Paket mir sanft aus der Hand und bemerkte:
»Nicht wahr, es macht doch eine ganz gute Gattung.«
Sie meinte wohl, dass der Artikel sich recht präsentabel und manierlich ausnehme, und ich sagte auch:
»O ja, es sieht ganz annehmbar aus. Wofür soll denn die Sache gut sein, wenn ich fragen darf?«
Da wurde die Frau sichtbar verlegen und sagte:
»Ja, um die Luft zu reinigen. Dazu ist es eigentlich bestimmt.«
Ich dachte, es käme ein »aber« und wartete. Aber es kam nichts.
»Und ich soll das also verkaufen?« fragte ich.
»Ja, wenn Sie das wollen,« sagte die Frau und sah mich beinahe hilfesuchend an, so dass mich ein lebhaftes Mitleid ergriff. Ich merkte, wie sehr den armen Leuten daran gelegen war, die vielen Tausend Exemplare loszuwerden, und sah schon im Geiste ein grosses Arbeitsfeld vor mir; aber das war es ja gerade, was ich suchte. Deshalb sagte ich auch schnell:
»Ja, ich werde soviel davon verkaufen, wie mir nur irgend möglich sein wird. Ich werde mir rechte Mühe geben. Wie teuer ist denn die Geschichte? Und haben Sie vielleicht einen kleinen Laden, wo ich die Sache verkaufen kann?«
Ich malte mir schon aus, welch drollige Auslage ich mit dem bunten Zeug machen könnte und was für Türme und Häuser ich bauen wolle. Die Frau notierte derweilen die Preise auf eine Kaffeetüte, die sie, wie vorbereitet, aus der Küchenschürze zog:
»Nein, einen Laden haben wir nicht. Sie müssen die Kundschaft selbst aufsuchen. Sehen Sie: hier sind die Preise. Die Grosskartonierten kosten eine Mark zwanzig; davon bekommen Sie zehn, oder sagen wir fünfzehn Pfennige. Die Kleinen, Lädierten, auf denen die goldbuchstaben verblasst sind, können Sie für fünfzig, sonst für sechzig oder fünfundsechzig Pfennige losschlagen. Sie werden ja sehen, wie das Geschäft Ihnen von Hand geht.«
Ein Laden hätte mir freilich unbändigen Spass gemacht. Mit meiner Tändelschürze hinterm Ladentisch stehen und es immer flott klingeln hören und sagen: » Was wünschen Sie?« oder: »Womit kann ich dienen?« -: das wäre nach meinem Geschmack gewesen. Aber wenn ein Laden nicht da ist ...? So werde ich, weil es nicht anders geht, eine kleine Hausiererin und ziehe von Haus zu Haus. Bekomme auf diese Weise vielleicht allerlei Hübsches zu sehen und bin auch täglich in der frischen Luft.
So malte ich mir meinen künftigen Beruf aus, und man übergab mir einen grossen Karton, vollgepackt mit den sogenannten Desinfektionsapparaten. Das Wort allein schien mir eine gute Sprachübung zu sein und ich dachte, wenn ich nur nicht über das Wort schon stolpere.
Das schüchterne Ehepaar indessen schien geradezu gerührt über meine Bereitwilligkeit. Sie verabschiedeten mich so freundlich, beinahe als sei ich ihre Tochter, und so schon ich recht glücklich, meinen neuen Erwerbszweig unter dem Arm, über die Strasse.
Am liebsten hätte ich gleich mein Glück versucht. Die grossen Häuser stachen mir sehr verlockend in die Augen.
In einem Treppenhaus versuchte ich das fest verschnürte Paket zu öffnen, aber es gelang nicht. Es war so fest verschnürt, dass ich mich hinsetzen musste und die Knoten mit den Zähnen zu öffnen versuchte.
Ein Portier, der die goldenen Teppichstangen wegnahm, um die Treppe zu putzen, fragte mich, was ich denn da wolle. Aber ich gab ihm ganz keck zur Antwort, ich habe die Absicht, blühende Wiesen im Winter zu verkaufen.
Was er damit meinte, verstand ich recht, aber ich musste mit meinem halb geöffneten Paket mich trollen, und gerade dieses Haus hatte ich mir für meine erste Kundschaft ausgesucht.
Meine Wirtin erklärte den Ozongeruch für einen gesundheitsschädlichen Humbug, und ich hatte grosse Mühe, ihr diese Ansicht auszureden. Sie war von der Überflüssigkeit meines Artikels so durchdrungen, dass sie das Paket in den Aschkasten werfen wollte.
Da hab’ ich aber sehr geweint und ihr gesagt, ich habe die Vertretung für den Ozongeruch und ich lasse nichts darauf kommen, und sie möge mich nicht beleidigen, sonst würde ich ausziehen.
Da ist sie denn still geworden und hat gesagt: »Na, meinetwegen, versuchen Sie Ihr Glück mit dem Schwindel.«
________________________________________
Das Brandmal, Ein Tagebuch, von Emmy Hennings, Seite 71-77, 1920 - transkribiert ohne Eszett
Dagny, die Protagonistin in Emmy Hennings' Buch Das Brandmal, das genau vor hundert Jahren beim Erich Reiss Verlag erschien, erzählt in einer wagen Tagebuchform ein dringliches Leben im Prekariat. Der zitierte Eintrag aus den Seiten 71 bis 77 hinterlässt eine womöglich unfreiwillige Komik aus der jetzigen historischen Perspektive.
In der sonst öfters grausamen Selbstbefragungen von Dagny liest sich dieser Abschnitt in einer leichteren Theatralik, wie Dagny in der Jobsuche ihre Flexibilität testet oder testen muss, obwohl sie von einem festen Arbeitsplatz in dieser Situation träumt. Es wirkt unfreiwillig fast schon zynisch, einem nachträglich erwiesenen gesundheitsschädlichen Desinfektionsapparat mit dem Namen Ozongeruch die zusätzliche Aufschrift blühende Wiesen im Winter zu geben, wenn man die heutige Klimaerwärmung und die Corona-Krise vor sich in den Gedanken hat. Emmy Hennings erwähnt in einem Dialog diese Tätigkeit, gefolgt von einem sehnsüchtigen Kommentar, schon in ihrem um 1919 erschienenen, autobiographischen Roman Gefängnis. 1940 taucht eine weitere Notiz im Das flüchtige Spiel auf.
Im Emmy Hennings, Das Brandmal – Das ewige Lied (herausgegeben von Christa Baumberger und Nicola Behrmann, 508 Seiten, Göttingen, Wallstein, 2017) schreibt Nicola Behrmann im Nachwort mit dem Titel Die Strasse schreiben: Das 1920 erschienene Tagebuch »Das Brandmal«, die Aufzeichnungen einer durch die Städte vagabundierenden und dabei gottsuchenden Schauspielerin, und die drei Jahre später publizierte Erzählung »Das ewige Lied«, der Fiebermonolog einer Typhuskranken, sind zwei ebenso verstörende wie verstörte Texte, in denen sich mystische Rede, Bekenntnisse und wirre Träume miteinander verschränken. Diesen Büchern gerecht zu werden, von denen das erste wenigstens für kurze Zeit ein sensationeller Erfolg wurde und dann in Vergessenheit geriet, während das zweite von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt geblieben ist, bleibt eine Herausforderung.
In dem vor paar Jahren angekündigten Aufkommen einer Literaturgattung, die sich ausschliesslich mit der autofiktionalen Schreibweise befasst, kann Das Brandmal auch als ein sehr aktuelles Werk gelesen werden. So befinden sich bei Emmy Hennings Biographie und Schrift in einer schwer vermessbaren Verknüpfung. Bei einem breiten Aufkommen der Autofiktion kann auch eine Kritik an einer Armut der Fiktionen formuliert werden. Dabei kann sich die Frage stellen, ob die Dringlichkeit - bei Hennings also eine oft existenzielle - der Fiktionalität bildlich gesprochen in die Quere kommt. Hennings Erfahrungen aus einer prekären Lebenssituation, dem Gefängnis, der Prostitution und der Unterhaltung sowie dem Drogenkonsum könnten zu einem breit gelegten Innenleben geführt haben, das stets mit dringlichen Introspektionen schriftlich getestet wird und immer wieder auf neue Weise mit der Umgebung verglichen wird. Sind wir dann also bei einer Reporterin ihrer Zeit? Ein nicht veröffentliches Tagebuch weist Strategien des Zu-Sich-Sprechens auf, während eine Autobiographie sich einer allgemeinen Verständlichkeit bemüht. Die Autofiktion dagegen muss nicht dazwischen sein, sondern ist zu einem Teil gezwungen eine neue Form zu entwickeln. Zum anderen Teil ist die neue Form genau die Befreiung aus der Autobiographie, aus welchem Grund und Begehren auch immer.
Ich weise bei dieser Gelegenheit gerne auf unsere Bibliothek, den noch kleinen und frischen Bücherverkauf und unsere Ausstellung hin, in denen auch die Ersterscheinung von Das Brandmal betrachtet werden kann oder die umfänglichen Publikationen über Hennings' Werk von Christa Baumberger und Nicola Behrmann gekauft werden können.
John Heartfield, der sich aus seinem deutschen Namen selbständig befreit hatte, gestaltete das Buchcover zum Das Brandmal. Im gleichen Jahr verfassten George Grosz und John Heartfield ein bekanntes Pamphlet mit dem Namen Der Kunstlump, das als der politischste Moment von Dada in gewisser Rezension gezählt wird. Zu Heartfield gibt es einen Blogeintrag von mir in einer anderen Woche. Auch als Nachtrag zur 75 Jahre Befreiung, dem 8. Mayday.
Bis dahin empfehle ich den üppigen Online-Katalog mit hochaufgelösten Bildern zu den Werken von John Heartfield: http://www.heartfield.adk.de/
Lorik Visoka

Emmy Hennings, Fotografie von Hans Holdt, 1921-1922, Quelle: Schweizerisches Literaturarchiv