Emmy Hennings - Anekdoten über Zürich
Eine Textauswahl über Zürich, das Niederdorf, das Cabaret Voltaire und Dada
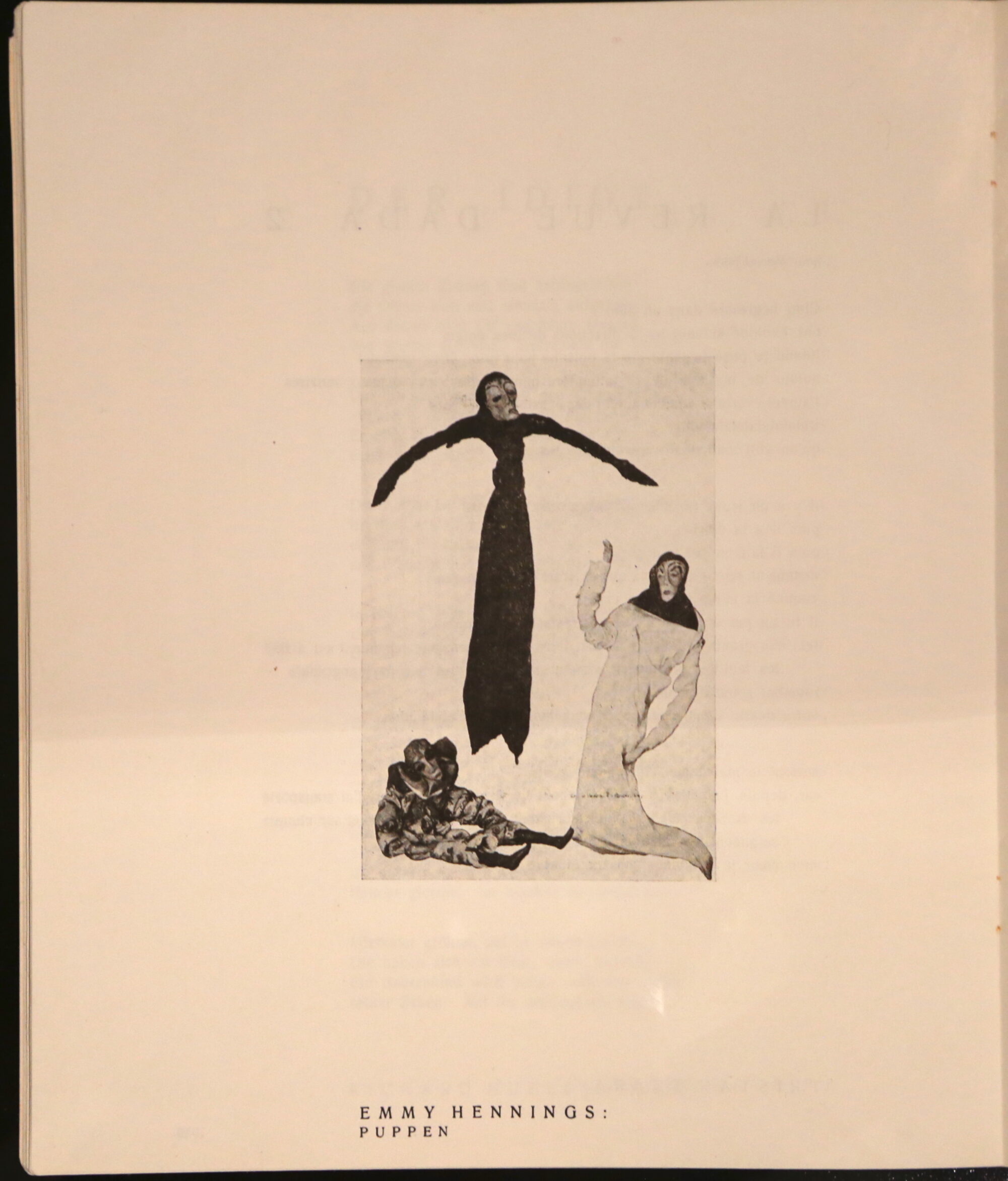
Cabaret Voltaire Heft, Abbildung mit Puppen von Hennings auf Seite 20,
1916, Faksimile des Schweizerischen Literaturarchivs, zu sehen in der Ausstellung Emmy Hennings / Sitara Abuzar Ghaznawi.
Wir gingen ins Niederdorfviertel, wo sich verschiedene Altwarengeschäfte befanden, die fast alle geschlossen waren [...] Wir standen mit unserem Karton, in dem sich der Frack befand, vor dem «Hirschen», wo man den Singsang Variété, Klaviermusik, berauschte Trommel und dumpfes Gong, bis auf die Strasse hinaus hörte [...] Wir sahen im Fenster die Reklamebilder an. Das herrliche Bild des Feuerfressers Flamingo, ein Rudel Mädchen in Flitterröckchen, Fred, den Schlangen- und Froschmenschen, und Leporello im Flitterkleid als König der Zauberer. Wir hörten mit viel Schmiss und Schwung ein Indianerlied singen, richtige Wildwestromantik [...]
Wir kamen auf den Gedanken, es gebe vielleicht da drinnen im «Hirschen» einen Humoristen, der unseren Frack brauchen könne. Hugo traute sich nicht recht in den Lärm hinein und schickte mich voran, die Möglichkeiten zu erfragen. Er wollte draussen warten, bis ich ihn rief.
Ich kam lange nicht wieder, liess meinen Hugo warten und warten. Er muss meine Stimme von draussen gehört haben, und als er sich entschloss, endlich das dichtbesetze Lokal zu betreten, brauchte er mich nicht lange zu suchen; denn ich stand in einem geborgten, silbrigen Lamékleidchen, das mir vortrefflich passte und in dem ich mich wie zu Hause fühlte, Probe singend, auf der Bühne. Die «Valse brune» konnte der Pianist auswendig spielen, sicher wie Gold, und da konnte ich getrost loslegen: «Nur Liebe ist Leben» und so weiter. Um Handumdrehen war ich engagiert, und von Direktor Feuerschein wurden mir sofort fünfzig Franken Vorschuss beinahe aufgedrängt, damit ich nur ja kein anderes Engagement abschliessen sollte. Jetzt war von Frackverkaufen nicht mehr die Rede. Ich meinte, der Frack wollte selbst nicht von uns weg, und wenige Tage später konnte Hugo ihn sehr gut brauchen, denn es wurde als Pianist bei der Truppe Flamingos engagiert
– Ruf und Echo. Mein Leben mit Hugo Ball, 1953, Erinnerung aus der Zeit kurz vor dem Cabaret Voltaire
______________________________
Es war im Kriegsjahr 1917 in Zürich. Im Cabaret Voltaire war soeben der Dadaismus geboren worden. Der Dadaist kämpfte gegen die Agonie, gegen den Todestaumel der Zeit. Im Widerspruch behauptete sich das Leben. Jede Art von Maske war dem Dadaisten recht. Die Maske jedoch diente als notwendiger Unterschlupf, das wahre, zu tief erschütterte Gesicht zu verbergen. Beim Dadaismus war viel Verzweiflung an der Zeit mit ungebrochener, jugendlicher Kraft gepaart, die oftmals wie Übermut und Spottlust anmutete. Selbstverständlich freuten sich die Dadaisten königlich, dass es ihnen so leicht gelungen war, ein höchst verblüfftes Publikum, möglichst nach einer Kur von nur fünf Minuten, in die gewünschte Rage zu bringen, es vorerst einmal ausser Rand und Band zu führen. Erst nachdem dies geschehen war, konnte man sich zufrieden verabschieden und den Dadaismus allmählich den besseren Familien überlassen.
– Emmy Hennings, Erinnerungen an Sophie Taeuber, in: Sophie Taeuber-Arp, hg. von Georg Schmidt, Basel, Holbein-Verlag, 1948
______________________________
In unseren kleinen Zimmern am Predigerplatz ging es hoch und immer höher her. Dem Wiener Chik der Frau Thesa machten wir die absurdeste Konkurrenz. Ball entwarf Kostüme aus Pappe, die mit Glanzpapiere in allen Farben beklebt wurde. Es starrte von Rüstungen und Reifröcken, von Nonnengewändern und Harlekinhosen. Da die Kostüme des Materials wegen viel Raum in Anspruch nahmen, mussten wir sie mit Schnüren am Plafond befestigen und wenn wir sie durch die Strassen trugen, gab es einen solchen Menschenauflauf, dass wir uns entschliessen musste nur nachts unsere phantastische Garderobe ins Kabarett zu befördern. Unser Zimmer aber wurde nie leer und die Arbeit hörte niemals auf. Plakate wurden entworfen, Masken geschminkt und unsere Schreibmaschine, die wir auf Abzahlung genommen hatten, stand kaum je still. Die Einladungen mussten geschrieben werden und die neuesten Manifeste, Hülsenbeck diktierte sein «Poéme simultane», Frank seinen Bürgerroman Ball in die Maschine. Dann wieder kam Marcel Janco, der Rümäne, der Masken entwarf, die widerum zu den Kostümen passen mussten, russische Balalaikaspieler kamen nach dem Programm fragen, kurz, bei uns gings ein und aus.
– Rebellen und Bekenner, 1929
______________________________
Wir übersiedelten aus der Spiegelgasse in die Bahnhofstrasse, wo im Sprünglihause die Galerie dada gegründet wurde. Gezeigt wurden zunächst die futuristischen und kubistischen Bilder der damals bekannten Sturmausstellung, der Sammlung von Herwarth und Nell Walden, die Han Coray zum erstenmal in die Schweiz gebracht hat. Ein wenig später fand eine reizende Ausstellung von Kinderbildern statt, Bilder aus verschiedenen Jahrhunderten, alles von Kindern gemalt. In den schön eingerichteten Ausstellungsräumen wurden verschiedene Vorträge veranstaltet, Soireen, die sehr gut besucht waren trotz hoher Eintrittspreise. Man war recht vornehm geworden und musste offenbar bleiben. Der Dadaismus wurde geschoben und weiter geschoben, nicht nur von den Dadaisten selbst. Er war da und irgendwie auch schon verloren, um nicht zu sagen «überholt», sobald er von der Presse und vom Publikum ernsthaft anerkannt wurde.
– Ruf und Echo. Mein Leben mit Hugo Ball, 1953
_____________________________
DAS KABARETT VOLTAIRE UND DIE GALERIE DADA
Viele Schweizer Familien hatten Ferienkinder aus den Kriegsländern eingeladen. Die kleinen Gäste kamen an, schmal, bleich, hohläugig, um hier aufzublühen wie junge Rosen. Wie viele, die inzwischen herangewachsen sind, werden sich dankbar zurückerinnern! «Wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.» Ferner war eine unzählige Anzahl Fremder freiwillig gekommen, für die Zürich die hohe Warte war, von der aus man das Weltgeschehen ruhig oder entsetzt beurteilen konnte. Die Stadt war damals das Internationalste, das man sich denken kann. Am Quai hörte man in allen Zungen sprechen.
Mit meinem spätern Mann, dem Dichter Hugo Ball, der damals grau wie Asche aussah und hager, als sei er aus Baumwurzeln geflochten, spazierte ich dort oft auf und ab. Nicht frei von Neid sahen wir zu, wie die Möwen und Schwäne gefüttert wurden. Wovon wir uns selbst nährten, scheue ich mich zu sagen. Wir führten in jenen Tagen einen Karton mit uns, in dem sich ein Frack und ein weisses Hemd mit Kragen befand. Ball träumte davon, eine Stellung als Kellner zu finden. Fragte ich ihn, warum er durchaus das werden wolle, so antwortete er: «Ich will den Menschen dienen!» Er meldete sich auch im Hotel «Baur au Lac», in dem gewiss schon mancher Kellner sein Brot gefunden hat; aber er wurde abgewiesen.
Schliesslich lernten wir einen internationalen Künstlerkreis kennen, der auf den Gedanken verfiel, in der holländischen «Meierei», an der Spiegelgasse, das Kabarett Voltaire zu gründen, das die Wiege des später berühmt gewordenen Dadaismus werden sollte. Ob er gerade eine Wohltat für die Schweizer wurde, will ich nicht untersuchen. Zunächst unterhielten sich die jungen Künstler selbst, indem sie täglich neue Möglichkeiten in sich entdeckten.
«Ein deutscher Dichter seufzt französisch.
Rumänisch klingt an siamesisch.
Es blüht die Kunst Hallelujah.
‘s war auch schon mal ein Schweizer da.»
So dichtete Klabund über das Kabarett. Mit dem Schweizer meinte er vielleicht den Romancier J.C. Heer, der allerdings unser treuer Stammgast war. Beinahe jeden Abend fegte er, sich nach allen Seiten umblickend, mit seinem Radmantel eine Anzahl Gläser vom Tisch, die er immer gern bezahlte. Eintritt wurde nicht erhoben, so dass der kleine Raum stets dicht und bunt besetzt war. Nach dem Grundsatz von Hans Arp: «Man soll seinen Viktor nicht unter den Scheffel stellen», wagte sich auch mancher aus dem Publikum aufs Podium, und brachte er seinen Kram nicht allzu vernünftig vor, so durfte er bestimmt auf Beifall rechnen. Man musste, ähnlich wie Ball, behaupten, «ein Pferd macht müde sich’s bequem in einem Vogelneste.» Anstatt:
«Füllest wieder Busch und Tal
Still mit Nebelglanz»,
hatte man wie Richard Huelsenbeck zu dichten:
«Füllest wieder Busch und Schloss,
Pfeift der Rehbock, hüpft das Ross.»
Das leuchtete nun freilich nicht jedem ohne weiteres ein, und mancher schüttelte den Kopf oder verliess unter Protest das Lokal. Da gab’s oft noch unter der Tür Meinungsverschiedenheiten, und immer bildete sich eine Partei, die gläubig hingenommen zu sehen wünschte, was wie eine Offenbarung vorgebracht wurde.
«Hebt und senkt, hebt und senkt,
Bis der Schwan am Galgen hängt.»
(Vielleicht doch eine Reminiszenz an Schillers «Glocke».)
Es wurde in unheimlich wirkenden Larven und Panzern getanzt, die an Tanks und Gasmasken erinnerten, an die furchtbare Ausrüstung des Krieges, wie die wilde Zeit überhaupt auf die Kunst abfärbte. Gebannt unter dem Zwang der Zeit stehend, regte sich lediglich das Tumultane in ihren Jüngern, obwohl es meines Empfindens nach die Aufgabe der Kunst ist, zu klären und nicht zu verwirren. Es geschah keine Verwandlung, das Simultane wurde komplexhaft, unmittelbar geboten. Dennoch ist aus diesem Benommensein von der Zeit etwas entstanden, was man eine Kunstrichtung nennt: Der Dadaismus, der erst recht aufblühte, als kein Grund mehr für ihn vorhanden war und die eigentlichen Schöpfer Hülsenbeck und Ball zu einer grossen Einfachheit des Stils zurückgekehrt waren (Uns ganz nahe in der Spiegelgasse wohnte Lenin, der natürlich keine Zeit hatte, unsere Vorstellung zu besuchen. Er muss die lauten, bruitistischen Konzerte wohl vernommen haben, doch liess er sich dadurch offenbar nicht stören. Tagsüber sah man ihn manchmal mit einem unbeweglich steinernen Gesicht, eine unscheinbare Aktenmappe unterm Arm, versunken die Strasse herunterkommen, und nachts, wenn wir heimgingen, sahen wir hinter seinem Fenster noch Licht brennen.)
Irgendwie vornehmer und daher weniger populär wurden die Darbietungen in der Galerie Dada. Mich wundert noch heute, dass der Besitzer des Sprünglihauses seine schöne Acht-Zimmer-Etage an der Bahnhofstrasse ohne jegliche Garantie an uns vermietete. Freilich, er konnte nicht wissen, was ihm bevorstand. Die Dadaisten hatten meistens mehr Ideen als Franken in der Tasche. Der Rumäne Tzara besass neben einer Sammlung eigener Gedichte, daran er kindlich-glücklich mit ganzer Seele hing, eine schöne Negerplastik, die im Wert zu einer phantastischen Höhe hinanstieg. Falls Geldschwierigkeiten eintreten würden, sollte die schöne Negerin am liebsten versetzt werden, denn sich für immer von ihr zu trennen, wäre ihm zu schwer gefallen. Er hatte es auch nicht nötig und freut sich, glaub ich, noch heute ihres Besitzes. Die Negerplastik wurde feierlich aufgestellt, und da sie als einzigster Kunstgegenstand nicht genügte, liess man aus Berlin die grossen Sturmkollektion kommen, die abstrakten Bilder von Kandinsky, Feininger, Klee, Campendonk, und behängte damit alle Wände. Möbel wurden aus dem Antiquariat Corray herbeigeschafft. Ich persönlich liess es mir angelegen sein, eine grosse Anzahl Küchenhocker als Sitzgelegenheit für unsere vornehme Kundschaft in allen Ostereierfarben zu beizen, aber dieses löbliche Tun bekam mir schlecht, weil gleich bei der ersten Soirée die zarten Kleider der Damen sich ihnen abfärbten. So sahen auch sie ziemlich abstrakt aus: Kompositionen in Blau, Grün, Gelb, Rot. Unfreiwillige Farbensinfonien. O, diese wandelnden Palletten, die gerade ich, die ich mich nach Unauffälligkeit sehnte, verursachen musste!
Tagsüber ging’s verhältnismässig still bei uns zu. Es wurden kleine Vorträge über Ex- und Impressionismus sowie über andere Ismen gehalten. Einmal kamen sogar zwei Kriminalbeamte, die ganz Ohr und Auge waren, wenn auch etwas verdutzt. Sie hoben mehrere grosse Kandinsky hoch, um zu prüfen, ob die Bilder auf der rückwärtigen Seite auch bemalt sein. Vielleicht auch, um nachzusehen, ob sich hinter den Bildern Geheimfächer oder Likörschränke befanden. Wirtschaften durften und konnten wir ja nicht. Bald wurde mystische, mittelalterliche Lyrik vorgetragen; dann tanzten einige Labanschülerinnen sehr schön, und dazwischen wurde Chinesisches oder Dadaistisches geboten mit dazu passenden Manifesten. Ein einziges Mal verkauften wir ein kleines, buntes Seidenbild um 150 Franken. Wir hätten es auch im dreissig Franken gegeben, ja noch für viel weniger, aber die Dame wollte durchaus 150 Franken zahlen, eine Zuvorkommenheit, die mich vor Freude beinahe schwindlig machte, da es sich zufällig um ein kleines Werk meiner spielerischen Hände handelte, einen Blütenbaum, der für eine Tombola bestimmt war. Jetzt bekam ich plötzlich irrsinnig viel Geld auf die Hand gezählt. Es herrlicher, unvergesslicher Augenblick! Kaum war die Dame fort, als ich auch schon in die Küche eilte, wo die ganze Dadaisten wartend beim Kaffee sassen. Hier teilte ich mit, was mir begegnet. Mein Mann war nun zwar der Ansicht, dass man mir mancherlei anvertrauen könne, aber bei Geld sei entschieden Vorsicht geboten. Darum wurde es mir denn auch bis auf zwanzig Franken sogleich wieder abgenommen, doch fühlte ich mich auch damit noch reich genug. Sofort machte ich mich auf den Weg, es loszuwerden.
Es lag damals im Schaufenster bei Jelmoli ein frohroter Seidenschal, der es mir schon längst angetan hatte. Bis dahin wusste ich freilich nicht, dass ich ihn einmal selbst tragen würde. Die Farben ändern, je nachdem das Licht fällt, noch heute zauberisch. Ich dachte, das Publikum mit diesem Schal in eine kleine staunende Freude zu versetzen und dazu Volkslieder zu singen. Wie ein Stück fürs Leben lag er vor meinen Augen, beinahe eine Weltanschauung, die ich mir unbedingt erstehen musste. Ich habe ihn mir als hübsche Erinnerung an diese Sturm-und-Drang-Zeit bis heute aufbewahrt.
– Neue Zürcher Zeitung, Erste Sonntagsausgabe vom 27.05.1934
_____________________________
Zusammengestellt von Lorik Visoka
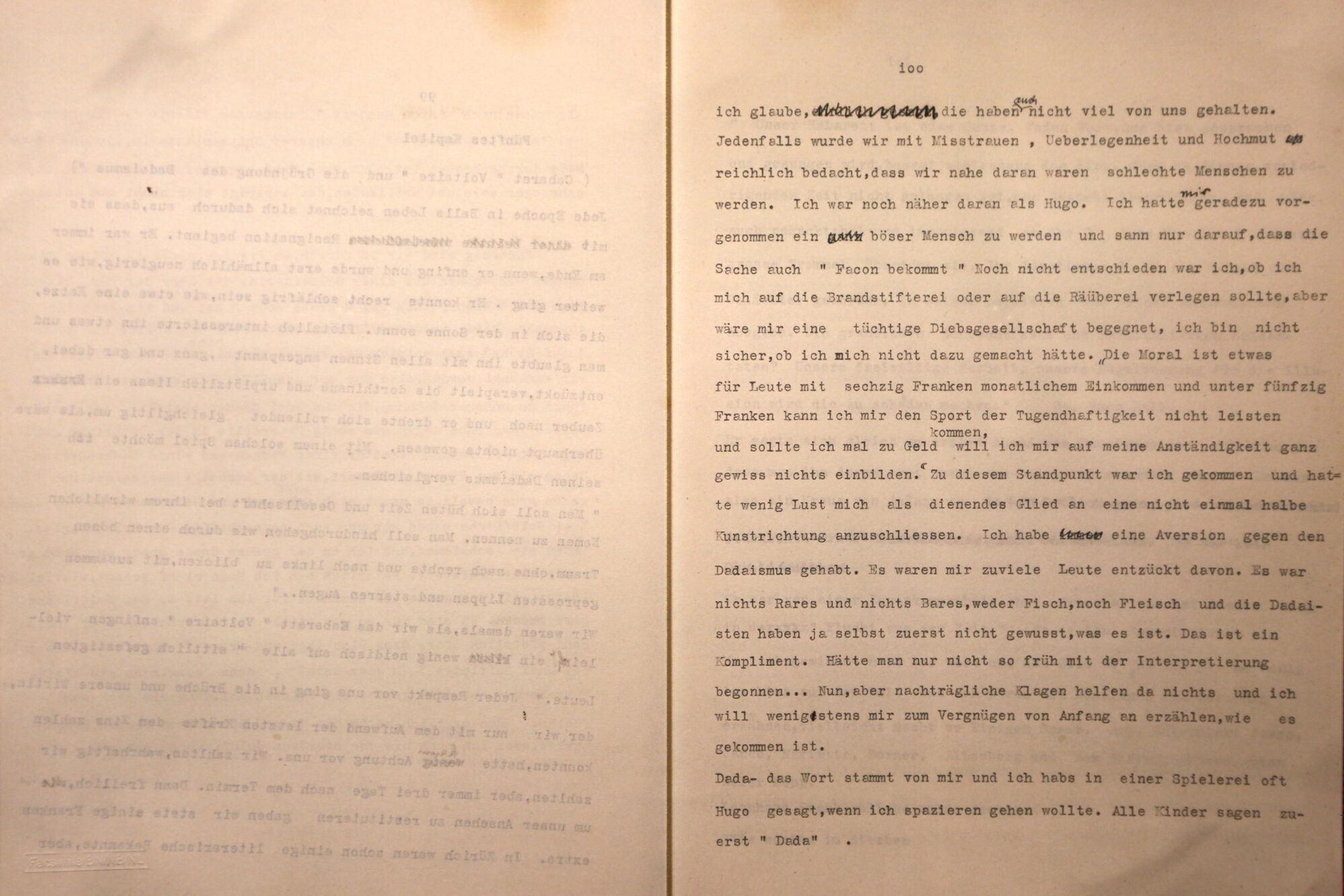
Rebellen und Bekenner, 1929, Faksimile des Schweizerischen Literaturarchivs, zu sehen in der Ausstellung Emmy Hennings / Sitara Abuzar Ghaznawi.